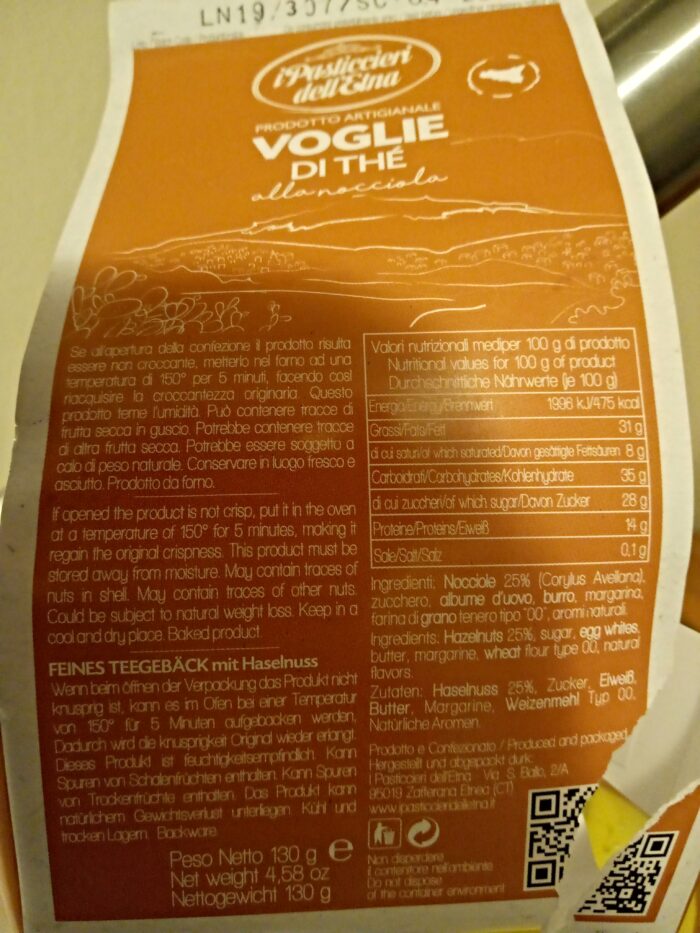Das Phänomen der Prokrastination ist sicher keines, das man würdigen sollte. Doch manchmal verschlägt es einen auf Internet-Seiten, die eigentlich in keinem Zusammenhang mit einer gezielten Recherche stehen. Es war der 21.04.20, als ich in einer Pressenotiz einen Satz vernahm, der mich sofort in den Bann zog:
Wäschespinnen laufen gerade wie Hölle.
Dieser Satz stammt von Henner Rinsche, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG mit Sitz im hessischen Nassau. Er wurde am 18.04.20 in einer dpa-Meldung verbreitet. Leifheit ist mir als renommierter Haushaltsgerätehersteller vertraut. Wäschespinnen kenne ich ebenfalls mehr oder weniger gut, also habe ich den Satz einwandfrei als Erfolgsmeldung verstanden. Doch hat es dieser einfache Satz in sich, denn bildlich ist er auf dreifacher Ebene anschaulich:
Eine Wäschespinne ist anders als eine Vogelspinne frei von Gefahren und einfach nur nützlich, um nasse, saubere Kleidung ganz natürlich an der Sonne trocknen zu lassen. Die Form des Gerätes erinnert an eine Spinne. Eigentlich nichts, woran man weitere Gedanken verschwendet. Wäschespinnen, die jedoch „laufen“, haben schon etwas Pikanteres, denn hier stelle ich mir bereits wirkliche Spinnen vor, die vielleicht gerade aus einem Wäschekorb herauskrabbelt. Und diese Zuspitzung auf „Hölle“, eigentlich auf einen Ort, der wie kein anderer für Schrecken steht, kann zu einer Horrorvorstellung führen, die natürlich hier harmlos ist, beflügelt sie doch hier nur die Fantasie. Wohl aus dem Englischen „like hell“ ist dies eingeschwappt, so dass jetzt sogar verbrieft von „wie Hölle“ gesprochen wird, was Nachrichtenagenturen teilweise mit „sehr stark“ herunterkochen. Denkbar wäre auch „wie verrückt“; „höllisch gut“ klingt hingegen schon merkwürdig.
Die Kombination aus Insekt, Bewegung und einem fiktionalen Ort hat geradezu etwas Filmisches. Ein Surrealist hätte seine Freude dabei, hier einen Plot zu entwerfen. Die bekannten Ausdrücke „Ich spinne!“ und „zur Hölle (machen)“ sind negativ konnotiert, nur beim einfachen „(Es) läuft!“ denkt man an einen gewissen Erfolg.
Einige Tage später komme ich darauf, dass das englische „to spin“ etymologisch mit „spinnen“ verwandt sein muss. Es geht jeweils um eine Drehbewegung, die etwas sehr Dynamisches hat. Spricht man nicht sogar im Fitnessstudio vom „Spinning“?
„Ich bin am Spinnen ist uncool“, doch „Ich bin am Spinning-(Gerät)“ klingt nach einer durchtrainierten Person. Doch irgendwas klingt hier nach, was auch eine klare Drehbewegung ist: Eine vermaledeite „Virenschleuder“, die nicht klar zu definieren ist, kann einen Menschen genauso durchdrehen lassen wie eine „Virenhölle“, von der neulich ein lieber Freund nach einem Supermarktbesuch sprach. Begriffe, die an das Gegenteil von Sauberkeit denken lassen. Und nun als Kontrast dazu die Wäschespinne, die eigentlich der Abschluss eines realen Anti-Virus-(Wasch-)Programms ist: Erst die Kleidung möglichst heiß mit Waschpulver waschen, und dann ab in die Sonne. Die Weltgesundheitsorganisation rät angeblich zum Wäschetrocknen unter freiem, möglichst wolkenlosem Himmel. Wie wäre es, wenn die Wäschespinne sich dann auch noch um ihre eigene Achse drehen würde? Ich stelle sie mir dann wie ein Wäschekarussell mit ganz unterschiedlichen Anblicken vor…
Nun, meine Fantasie kommt hier nicht weiter. Doch sie ist schon ziemlich weit gekommen dank eines Satzes, der – nun lege ich mich fest – literarische Qualitäten besitzt, auch wenn er für die Öffentlichkeit als ganz ernstzunehmende Erfolgsmeldung geäußert wurde. Möge die Leifheit AG auch weiterhin gute Geschäfte mit Wäschespinnen machen, auch in nicht so virenlastigen Zeiten!
Hier der Kontext (Artikel in der Frankfurter Rundschau vom 19.04.) in reinstem Pressedeutsch. Übrigens ist ein reales Wäschekarus(s)ell käuflich beim Dänischen Bettenlager zu erwerben!