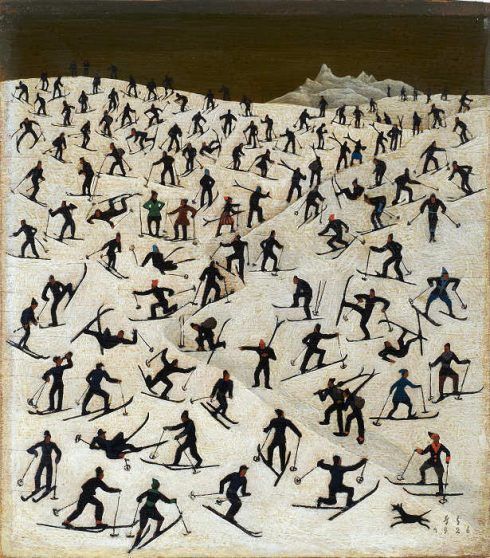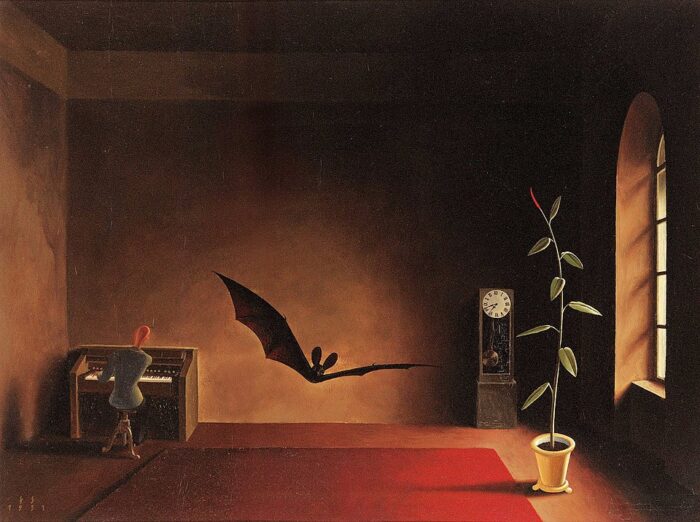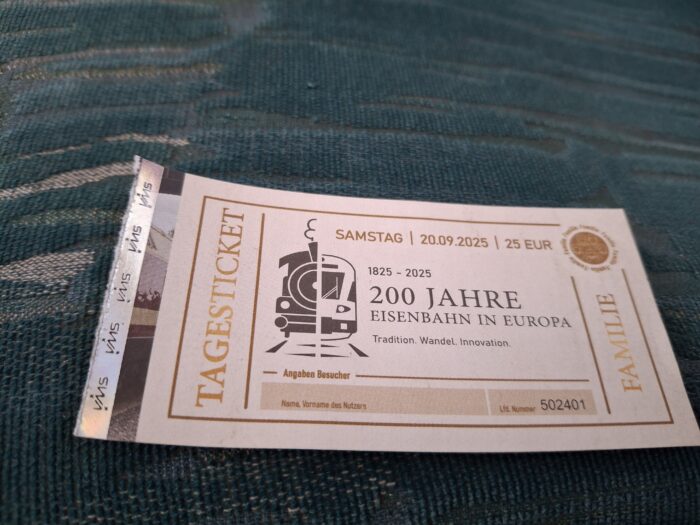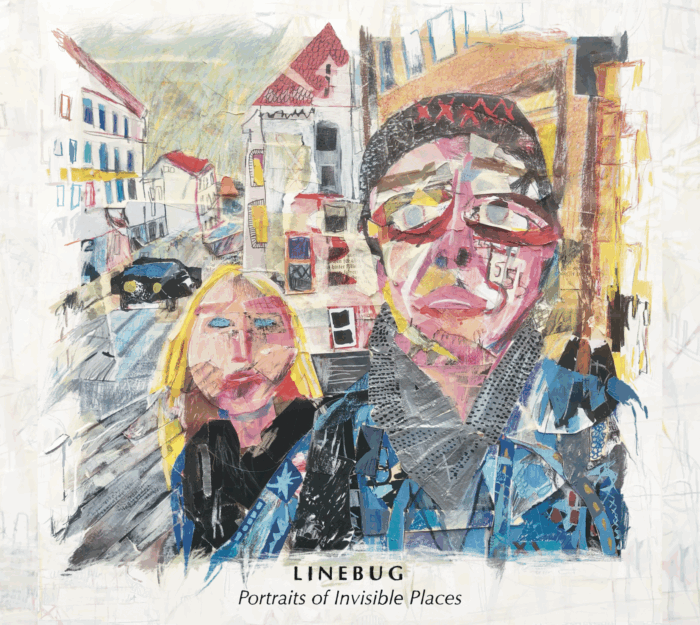Am 21.Dezember 2025, am kürzesten Tag des Jahres, las ich die mir vorher unbekannte Erzählung Doktor Murkes gesammeltes Schweigen (1955 bzw. erweitert 1958) von Heinrich Böll (1917-1985), der 1972 den Literatur-Nobelpreis erhielt. Ich kann mich noch sehr gut an den Lese-Ort erinnern, nämlich an den Dorfweiher von Bräunsdorf, einem Weiler von Limbach-Oberfrohna. Es war ein ungewöhnlich sonnig-milder Dezembertag, gerade angesichts des unterkühlten Januars.
Die Erzählung ist an anderer Stelle als sehr gelungene Hörfunksatire bezeichnet worden. Es scheint mir, dass jeder, der ein gutes Beispiel für eine Satire sucht, hier fündig wird. 2023 wurde der Text sogar in der Fachzeitschrift Praxis Deutsch behandelt (Nummer 299). Sehr hilfreich ist, besonders für Schüler, darin ein „Werkzeugkasten zum Verfassen von Satiren“, in dem sehr bündig (satire-)verwandte Grundbegriffe erklärt werden: Wer sich an einer Satire als Kunstform versucht, sollte wissen, was beispielsweise Groteske, eine Parodie und eine Persiflage meint, die ja als deren (möglicher) Bestandteil einen ähnlichen Bedeutungsumfang haben, nämlich eine Nachahmung, die verzerrt oder übertrieben sein kann (in diesem Fall eher eine Parodie) oder allgemein durch Verspottung kennzeichnet sein kann (dann eher eine Persiflage).
Eine Satire auf das hörfunkjournalistische Treiben der 1950er Jahre erscheint auf den ersten Blick nicht besonders aktuell. Doch es lassen sich einige zeitlose Aspekte finden, die auch Anfang des 21. Jahrhunderts eine gewisse Relevanz haben. Zeitgeschichtlich ist sicherlich, dass in einem Aufnahmestudio der Vortrag eines gewissen Prof. Bur-Malottke von Dr. Murke auf Wunsch des Autors bearbeitet werden muss. Dabei weist der Promovierte den Habilitierten an, wie am besten der Passus „jenes höhere Wesen, das wir verehren“ anstelle von „Gott“ einzusprechen ist, natürlich mit Rücksicht auf den Kasus, mit dem sich die Endungen der ersten beiden Wörter verändern. Handwerkliches Geschick war sicherlich erforderlich, um mit einer gewissen Schneide-Technik alte Tonband-Elemente durch neu aufgenommene zu ersetzen. Wie gut, dass heute die EDV so vieles weniger mühsam erledigen lässt!
Ein Auszug des neu geschnittenen Vortrages lässt das Unterfangen bewusst grotesk erscheinen. Im Vortragsmaterial geht es um das Wesen der Kunst mit Verweis auf eine höhere Macht, die nun nicht mehr als „Gott“ bezeichnet werden soll. Zeitlos ist dabei der Wunsch nach einer Korrektur (quasi eine nachträgliche Selbstzensur) im Zusammenhang mit einer geänderten Geisteshaltung: „Bur-Malottke, der in der religiösen Begeisterung des Jahres 1945 konvertiert hatte“, wünscht sich eine Formulierung, die „mehr der Mentalität entsprach, zu der er sich vor 1945 bekannt hatte“, auch weil er schuldhaft an der „religiösen Überlagerung des Rundfunks“ mitgewirkt habe. Hierzu fällt mir der Fragwürdigkeit des Begriffs „Stunde Null“ ein, da eben auch vorher Geltendes nicht einfach ausgelöscht werden kann, vor allem nicht in mentaler Hinsicht. Historiker könnten hierzu vieles kommentieren…
Kommen wir zum sprachlichen Aspekt: Für die einzusprechenden Änderungen nimmt er sich eine Viertelstunde Zeit. Dieser Zeitrahmen ist eindeutig zu knapp, angesichts der umständlich an ihn herangetragenen Aufgabe:
In den beiden Vorträgen kommt Gott genau siebenundzwanzigmal vor – ich müsste Sie also bitten, siebenundzwanzigmal das zu sprechen, was wir einkleben können. Wir wären Ihnen dankbar, wenn wir Sie bitten dürften, es fünfunddreißigmal zu sprechen, da wir eine gewisse Reserve beim Kleben werden gebrauchen können.
Murke wird diese Angabe noch präzisieren, wenn es um den Einsatz der Kasus (zehn Nominative, sieben Genitive, fünf Dative, und einmal sogar Vokativ!) geht. Da die neuen Einschübe länger ist als das zu ersetzende Material, muss der Vortrag laut Murke sogar um insgesamt eine Minute gekürzt werden! Und in der Erzählung erfahren wir, dass Bur-Malottke seine gesamten aufgezeichneten Vorträge aus politischen Gründen umarbeiten möchte! Umfang: 120 Stunden Archivmaterial!
Ganz offenbar wird in dieser Erzählung auch professorales Geschwätz mit wertvollem Schweigen konterkariert: Am Ende der Erzählung bittet Murke daheim in seiner Wohnung ein „Mädchen“ namens Rin, „wenigstens noch fünf Minuten Band“ zu „beschweigen“. Er sammelt also auf Vorrat Schweige-Material, das er sich ein einer ruhigen Minute auch am Stück anhört. Für ihn ist dies ein Hör-Genuss! Der Satz: „Du weißt doch, was Schweigen für mich bedeutet!“ ist ganz gewiss mehrdeutig. Einerseits kann er das Material für seinen Beruf verwenden, andererseits dient es auch seinem Wohlbefinden, gerade wenn soviel (fragwürdiges) Sprachmaterial verarbeitet werden muss.
Für ein Hörspiel, in dem ein Atheist nach dem Geschmack eines Hilfsregisseurs und eines Technikers zu viel Schweige-Zeit hinterlässt (nach der zweimal wiederholten Frage, wer noch nach seinem Tod an ihn denkt bzw. auf ihn wartet, wenn er „der Würmer Raub“ bzw. „zu Staub“ bzw. „zu Laub geworden“ ist) werden zwölf aus Bur-Marlottkes Vortrag herausgeschnittene Gott-Schnippel eingefügt. Die Verantwortung dafür übernimmt blindlings der Hilfsregisseur, der sich kurzerhand beim Techniker bedankt: „Sie sind ein Engel!“ Was für eine Recycling-Maßnahme! Die nun angefallenen (Schweige)-Schnippel werden in Murkes Sammeldose eingefügt. Ein ganz ungewöhnlicher Transfer von Material, das als Träger von abwesender Sprache fungiert und trotzdem Bedeutung trägt!
In digitalen Zeiten muss kaum noch am Schneidetisch Sendematerial bearbeitet werden: Was online ist oder auf Servern (zwischen-)gespeichert ist, lässt sich zwar einfacher als früher ändern, doch was geschieht mit früheren Versionen, die irgendwo anders abgespeichert oder aufgezeichnet worden sind? Man kann sich fragen, wie fatal heute undurchsichtige Paste & Copy-Aktionen sein können, gerade wenn sie mit Hilfe von KI-Assistenten bewerkstelligt werden. Ein unübersichtliches Wissensarchiv entsteht, das seinerseits auch parodiert werden muss, um besser zu verstehen, dass man auch seine eigenen Gedanken (ver-)fälschen kann, genauso wie Bilder und andere Artefakte. Das Prinzip der Opportunität lässt sich hier wunderbar studieren. Zeitlos ist dieses Prinzip ganz bestimmt!
Die Erzählung kann günstig bei Kiepenheuer & Witsch bestellt werden. Ich habe die Taschenbuch-Ausgabe des Aufbau-Verlags aus dem Jahre 1990 verwendet, in der noch andere Böll-Erzählungen enthalten sind. Sie trägt den Titel Der Geschmack des Brotes. Auf den Seiten 189-213 ist Dr. Murkes gesammeltes Schweigen zu finden. Das längere Zitat findet sich auf der Seite 192.
In der ARD-Mediathek ist die originalgetreue Hörspielfassung der Erzählung aus dem Jahr 1965 seit Oktober 2025 für ein Jahr abrufbar. Dies zeigt, dass heutige Hörfunk-Redaktionen den Text auch als wertvoll im 21. Jahrhundert erachten (eine weitere Hörspielfassung entstand in den 1980er Jahren). Ein etwa dreiviertelstündiger Film aus dem Jahr 1964, u.a. mit Dieter Hildebrandt, ist bei YouTube anzuschauen. Darin wird das Schweige-Motiv allerdings nicht so gut umgesetzt.
Der pädagogisch ausgerichtete Fachartikel in der Zeitschrift Praxis Deutsch unter dem Titel „[E]s wird ja auch nicht viel geschwiegen.“ Heinrich Bölls Doktor Murkes gesammeltes Schweigen als Satire auf den historischen und aktuellen Zeitgeist ist von Werner Schwarz verfasst worden. Mit diesem Artikel können hervorragend mehrere Unterrichtseinheiten für einen Leistungskurs Deutsch gestaltet werden.